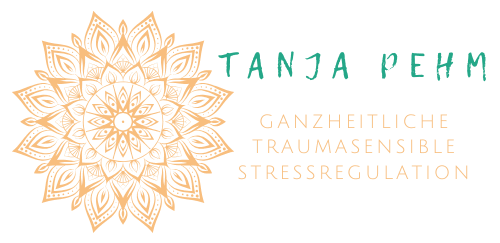Was ist Trauma?
Verstehen, was zu viel war – oder gefehlt hat.
Viele Menschen denken bei Trauma an schwere Unfälle, Katastrophen oder Gewalt.
Und ja: Das nennen wir Schocktrauma – und es ist real.
Aber Trauma kann auch ganz leise beginnen:
In der Kindheit.
In Beziehungen.
In vielen kleinen Momenten, in denen unser Bedürfnis nach Nähe, Schutz oder Gesehenwerden nicht erfüllt wurde.
Was ist Trauma – wirklich?
Das Wort Trauma kommt vom Griechischen und bedeutet „Verletzung“.
Und genau das ist es: Eine seelische oder körperliche Überforderung, mit der unser System nicht allein zurechtkam.
Wenn eine Erfahrung zu intensiv, zu langanhaltend oder zu einsam war,
dann spaltet sich etwas in uns ab – und der Körper reagiert mit Schutz:
Mit Anspannung.
Mit Rückzug.
Mit Strategien, die uns damals geholfen haben – aber uns heute blockieren.
Trauma entsteht nicht nur durch das, was zu viel war. Sondern auch durch das, was gefehlt hat.

Welche Arten von Trauma gibt es?
Schocktrauma
Plötzliche, überwältigende Ereignisse:
- Unfälle
- Naturkatastrophen
- Medizinische Eingriffe
- Gewalt oder Missbrauch
Das Nervensystem wird abrupt überfordert – und kann das Erlebte nicht vollständig verarbeiten.
Entwicklungstrauma
Entsteht oft früh im Leben:
- Emotionale Vernachlässigung
- Dauerstress in der Familie
- Überforderung oder fehlende Fürsorge
Das Nervensystem bleibt ständig im Alarmzustand – statt in sicherer Bindung.
Es geht nicht nur um einzelne Ereignisse, sondern um das Fehlen von Co-Regulation in sensiblen Phasen.
Die Folgen sind messbar: Gehirnbereiche wie Amygdala, Hippocampus oder der präfrontale Kortex entwickeln sich unter Dauerstress anders. Der Körper passt sich an – bleibt aber im Überlebensmodus.
Bindungstrauma
Wenn Bezugspersonen:
- nicht erreichbar waren
- widersprüchlich, übergriffig oder abweisend reagiert haben
Dann lernt ein Kind: Nähe ist nicht sicher. Ich darf nicht ganz ich selbst sein.
Die Folge:
- Wir unterdrücken Bedürfnisse
- Wir passen uns an
- Wir verlieren das Gefühl für unsere Grenzen
Diese Prägungen bleiben oft im Körper gespeichert, auch wenn wir uns nicht bewusst daran erinnern. Sie beeinflussen, wie wir fühlen, handeln, denken – und wie wir Beziehungen erleben.
„Trauma ist im Nervensystem gebunden. Es ist somit eine biologisch unvollständige Antwort des Körpers auf eine als lebensbedrohlich erfahrene Situation. Das Nervensystem hat dadurch seine volle Flexibilität verloren. Wir müssen ihm daher helfen, wieder zu seiner ganzen Spannbreite und Kraft zurückzufinden.“
– Dr. Peter A. Levine

Wie wirkt sich Trauma aus?
Viele Symptome im Heute haben ihre Wurzeln im Damals:
- Ängste, innere Unruhe, Überforderung
- Schlafprobleme oder chronische Anspannung
- Schwierigkeiten mit Nähe und Vertrauen
- Geringes Selbstwertgefühl oder Selbstzweifel
- Körperliche Beschwerden ohne erkennbare Ursache
Diese Reaktionen sind kein Versagen. Sie sind Schutz. Ein Versuch deines Körpers, mit dem Erlebten zurechtzukommen.
„Trauma ist nicht das, was passiert ist.
Sondern das, was in uns passiert –
wenn wir mit dem, was war, allein bleiben.“
– Gabor Maté
Was bedeutet traumasensibel?
Traumasensibel zu arbeiten bedeutet: Wir gehen nicht mit Druck an Veränderung – sondern mit Verständnis.
Wir erkennen:
- Dein Körper hat gute Gründe, so zu reagieren.
- Deine Schutzstrategien waren sinnvoll.
- Veränderung geschieht nicht durch Kontrolle –
sondern durch Sicherheit.
In einem traumasensiblen Raum darfst du:
- dich sicher fühlen – mit allem, was da ist
- deine Grenzen achten
- in deinem Tempo gehen
- wieder Verbindung erleben – zu dir und zu anderen
Es geht nicht darum, „schneller besser“ zu werden. Sondern wirklich in dir anzukommen.

Was du bei mir lernst.
- Wie Trauma wirkt – auch ohne bewusste Erinnerung
- Wie du beginnst, deine Reaktionen als sinnvoll zu verstehen
- Wie du mehr Ruhe und Sicherheit in deinem Körper spürst
- Wie du wieder vertrauen und Verbindung zulassen kannst
Denn echte Veränderung beginnt dort, wo dein System sich wieder sicher fühlt – und Nähe nicht mehr bedrohlich ist, sondern nährend.